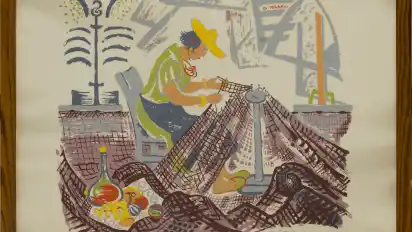Wer gewinnt den Pauli-Preis? In der jüngsten Ausstellung der Kunsthalle treten acht Künstlerinnen und Künstler an, um die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung zu erhalten, die bislang Kunstpreis der Böttcherstraße hieß und zum 49. Mal seit 1954 vergeben wird. Der Stifterkreis, Kunsthallendirektor Christoph Grunenberg und sechs Kuratoren aus deutschen und Schweizer Museen haben der fünfköpfigen Jury je einen Teilnehmer vorgeschlagen. In acht Räumen sind markante Positionen aus verschiedensten Genres und allen Generationen zu sehen – die bisherige Beschränkung auf den Nachwuchs wurde abgeschafft. Folgende Künstler präsentieren sich:
Benjamin Hirte ist gelernter Steinmetz, sein Interesse gilt der Architektur und städtebaulichen Elementen. Der 44-Jährige, der in Wien lebt, stellt unter dem Titel "True Sculpture" (Wahre Skulptur) vier Objekte aus rotem Sandstein aus, die wie Prototypen für künftige Bauten aussehen, aber in ihrem Zweck rätselhaft bleiben. Manche Elemente und Aussparungen erinnern an Dachgiebel, Brunnen oder Wasserrohre, auch eine Nagetierfalle hat der Künstler eingebaut. Aber die Funktionalität ist nur vorgetäuscht.
Gabriele Stötzer, 1953 in Thüringen geboren, unterschrieb 1976 den Protest gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann aus der DDR und wurde deshalb ein Jahr im berüchtigten Frauengefängnis Hoheneck inhaftiert. Die Verletzlichkeit und Stärke von Frauen, die sie dort erlebte, bildet sie seither in ihrer Kunst ab. In der Fotoserie "Heilerde" von 1982 zerlegt sie den weiblichen Körper in Kopf, Brust, Scham und Fuß. Die überlebensgroße Textilfigur "Meine große Schwester (2022) trägt das Gottessymbol des Dreiecks mit Lippen als Kopf. Wie hingewischt wirkende Tuschzeichnungen und ein an die Wand gekritzelter Text erinnern an die Isolierung im Knast.
Christof John aus Köln überführt die Malerei in den Raum. Der 40-Jährige stellt Paravents aus Holz auf, in die er scherenschnitthaft Muster gesägt hat. Gleichzeitig bemalte er die Holzplatten schräg mit dünnen und dicken Strichcodes in verschiedenen Farben. Optische Abweichungen sorgen dafür, dass diese Raumbilder trotz ihrer Größe eine große Leichtigkeit ausstrahlen. Auch sieben scheinbar gleiche Druckgrafiken weisen leichte Unterschiede auf.
Cemile Sahin, Wahlberlinerin kurdisch-alevitischer Herkunft, füllt in ihrer Rauminstallation "Gewehr im Schrank" die Wände mit historischen Soldatenbildern samt den Worten "Patrie" (Vaterland") und "Liberté" (Freiheit). Ein Video zeigt zu idyllischen Versen aus Friedrich Schillers "Wilhelm Tell" fiktive Kriegsszenen. Die 34-jährige Künstlerin möchte an den 1923 geschlossenen Vertrag von Lausanne erinnern, der die Grenzen der heutigen Türkei festlegte. Und daran, dass die neutrale Schweiz die höchste Dichte privat gelagerter Waffen in Europa aufweist.
Katrin Brause besetzt die Position der klassischen Malerei. Nicht Menschen, sondern ihre Hinterlassenschaften reizen die 1972 geborene Leipzigerin, der Verfall und seine Geschichte. Ein alter Hocker am Straßenrand und ein kaputter Stuhl, Heiligenbildchen an den Pfeilern öder Tiefgaragen oder mit schadhaftem Mobiliar verrammelte Hauseingänge in Catania auf Sizilien setzt sie wirkungsvoll in Szene.
Marcus Neufanger (60) aus Schwäbisch Hall zeigt zwei große, poppig wirkende Serien in Pastell-Ölkreide. Seine "Portraits" bilden Künstlerkollegen wie Marina Abramovic oder Lawrence Weiner ab, garniert mit vier Textgrafiken, seine "Cover Paintings" die Titel der Kunst- und Künstlerbücher auf seinem Schreibtisch.
Annika Kahrs , 1984 in Achim geboren und in Hamburg und Berlin tätig, hat ihr 25-Minuten-Video "Le Chant des Maisons" (Das Lied der Häuser) in der 1830 gebauten, heute verlassenen Kirche Saint-Bernard gedreht, in der die ausgebeuteten Seidenweber einst eine Heimstatt fanden. Im Schutt des Raums lässt sie Handwerker ein Holzhaus errichten, während Kinder- und Frauenchöre, ein Orgelbauer und eine Blaskapelle akustisch die Vergangenheit des Gotteshauses beschwören.
Jenna Sutela präsentiert im dunklen letzten Raum eine Glasskulptur, aus der Licht pulsiert, das drei Frequenzbereiche menschlicher Gehirnwellen abbildet, etwa den Tiefschlaf eines Babys. Im Glas erkennt man das Gesicht der 41-jährigen Finnin, die in Berlin lebt. Es spiegelt sich auch in zwei großen Schwarz-Weiß-Papierarbeiten.