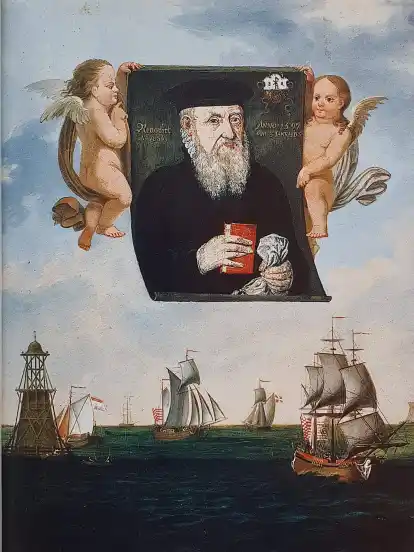Alljährlich am zweiten Freitag im Februar versammeln sich 300 festlich gekleidete Herren und inzwischen auch Damen zum Schaffermahl in der Oberen Rathaushalle – je hundert Kapitäne, Kaufleute und Gäste. Dabei wird für das Haus Seefahrt gesammelt, eine im 16. Jahrhundert gegründete Stiftung für bedürftige Seefahrer, ihre Witwen und Waisen. Brüning Rulves war sehr wahrscheinlich der erste alte Fahrensmann, der dort seinen Lebensabend verbrachte. Er war zwar erst 55 Jahre alt, hatte aber den Ruhestand verdient.
Seit seinem zwölften Lebensjahr war er zur See gefahren, zuerst als Schiffsjunge, dann als Matrose und später als Kapitän. Er blieb unverheiratet. Hinterlassen hat er ein in Schweinsleder gebundenes Buch mit Reisenotizen und Erinnerungen. Johann Focke, Namensgeber und Gründer des Museums, hat es übertragen und Auszüge im Bremischen Jahrbuch von 1916 veröffentlicht. Das Original ist im Zweiten Weltkrieg verschollen.
Rulves ist 1525 in Bremen als Sohn eines Bäckers zur Welt gekommen. Nach dem frühen Tod des Vaters heiratete seine Mutter den Schiffer Hinrich von Mynden. Kaum war Brüning zwölf Jahre alt, nahm ihn sein Stiefvater mit aufs Schiff zu einer Handelsfahrt nach Norwegen. Anscheinend kam der Junge an Bord gut zurecht, denn er blieb der Seefahrt treu. Zwanzig Jahre begleitete er seinen Stiefvater und stieg vom Schiffsjungen zum Matrosen auf.
Er war gewissenhaft und so lernbegierig, dass er mit 20 Jahren eine Bremer Rechenschule besuchte. Damit qualifizierte er sich für anspruchsvollere seemännische Aufgaben. Nachdem sein Stiefvater 1557 auf See ums Leben gekommen war, fuhr Rulves zeitweise als Kapitän und Teilhaber auf eigene Rechnung. Oder er heuerte bei anderen Bremer Schiffern als Schreiber oder Schiemann an. Damit war er für Verpflegung und Heuer der Besatzung wie auch für Tauwerk und Schiffsgerät verantwortlich.

Das barocke Portal des Hauses Seefahrt an der Hutfilterstraße, heute Eingang zum Seefahrtshof in Grohn, Lithografie um 1870.
Er befuhr Nord- und Ostsee sowie die Atlantikküste bis Spanien und Portugal, Haupthandelsgüter waren Rohholz und Fässer mit Salz, Roggen oder Fischen. Auch unter guten Bedingungen erreichten die dickbauchigen Frachtschiffe wie Kraweel, Schmack oder Holk nur ein gemächliches Tempo von sechs bis elf Stundenkilometern. Oft erschwerten Nässe und Kälte, widrige Winde, Stürme oder Flauten Arbeit und Leben an Bord. Verletzungen oder Todesfälle waren nicht selten.
„Anno 1544“, schreibt Rulves, „kam Schiffer Hinrich van Mynden von Danzig und wollte nach Holland. Kriegen unter Norwegen so schweren Sturm aus Westen, daß wir die Segel einnehmen so gut wir konnten.“ Eine Welle habe die Schute [Beiboot] losgerissen. Die schlug „den Scherbaum in Stücke, der aus dickem Holz war, und nimmt vier Mann über Bord. Zwei ertrinken: Johan Hylmer, der war unser Zimmermann, und Johan Specketer, der Schiffsjunge. Dem schlug die Schute zwischen Schute und Scherbaum Leib und Leben in Stücke.“
Rulves berichtet auch vom Tod seines Stiefvaters, der 1557 vor der dänischen Küste bei einer Havarie ums Leben kam: „Da kam der Wind in der Nacht so schwer an, daß wir dort strandeten Nachts vom Dienstag auf Mittwoch, als der Mond unterging, Nachts drei Uhr und Vater Hinrich van Mynden kam um mit 24 Mann […]. Gott erfreue die liebe Seele und sei ihr gnädig und barmherzig und auch uns andern, wenn wir nachfolgen sollen.“
Auch Seeräuber machten den Seeleuten das Leben schwer. Wenn möglich, half man sich gegenseitig. Nicht immer mit Erfolg. 1569, schreibt Rulves, kam in der Biskayabucht „stracks ein Freibeuter an auf [Kapitän] Johan van Stade und wir kamen ihm zu Hülfe, wie es Brauch ist, schlagen ihn ab wohl zweimal, er war 70 Mann stark.“ Ein Schiff aus Emden wollte helfen, „hat Geschütz, hat aber weder Blei noch Pulver dazu; der Freibeuter macht Morgens wieder klar, […] fällt dem Emder stracks an Bord, kriegt ihn, schlägt den Schiffer todt, verwundet etlich Volk, nimmt das Gut, das darin war.“
1575 hatte Rulves „die Pest an Bord“: „Von Emden […] liefen wir stracks aus der Ems in See und er kriegte gleich die Pestilenz der Schiffer Spyring. […] Er starb den 19. Juli, etwa 6 Uhr Abends; Gott sei der Sele gnädig." Der Leichnam blieb erst einmal in der Kajüte. Bei Bergen, so Rulves, wollten „wir ihn auf den Kirchhof bringen und nicht über Bord werfen. […] Es war aber windstill und […] er fing an zu riechen. […] Als wir ihn [in einen Sarg] hineinlegen wollten und die Kleider zurückschlugen war er so schwarz wie ein Mohr und stank, daß sich kein Mensch bergen konnte.“ Nach all dem kann man verstehen, dass Rulves seine letzte Reise mit den Worten kommentiert: „Anno 1579 den 12. September kam ich nach Bremen. Da war die Reise, Gott sei Dank, getan.“
Welche Perspektiven hatten alte und gebrechliche Seeleute, ohne Rente, oft ohne Familie? Nach der Reformation war das alte kirchliche Fürsorgesystem mit seinen Stiftungen und Almosen zusammengebrochen. 1545 nahm sich die Schiffergesellschaft („Gemeene Schipffarde unser Stad“) der Sache an. Mit Genehmigung des Rats legte sie einen von acht Vorstehern verwalteten Armenfonds („gemeine Kiste“) an. Daraus sollten in Not geratene Mitglieder, „jeder nach seiner Notdurft und Gelegenheit, unterhalten und versorgt werden, damit sie nicht nötig haben, […] auf der Straße zu liegen oder vor den Türen zu betteln und um Almosen bitten.“
Finanziert wurde der Fond mit Spenden, den traditionellen Gottesgeldern (bei Schiffsverkäufen und Heuerverträgen fälligen Gebühren) sowie den Bruchgeldern (gegen Besatzungsmitglieder verhängten Geldstrafen). Letztere sollten zwar eigentlich immer schon bedürftigen Seeleuten zugutekommen, waren aber oft nach dem Ende einer Reise bei „eitlem und unnützen Essen und Trinken“ verprasst worden.
Wie Anton Kippenberg in seinem Bremen-Buch von 1937 schreibt, übernahmen 1561 wohlhabende Kaufleute „an Stelle der oft und lange abwesenden, zudem meist geschäftsunerfahrenen Schiffer die Verwaltung der Anstalt […]. ‚Oberalte‘ blieben als Organe an der Spitze der Schifferschaft.“ Im selben Jahr erwarb der Fonds das erste Haus Seefahrt, ein zwar altes, aber geräumiges Gebäude an der Hutfilterstraße mit Wohn- und Verwaltungsräumen und angegliederten Buden.
Dort, so Kippenberg, „verbrachten die Witwen auf See gebliebener Schiffer oder altgewordene Seeleute friedlich ihren Lebensabend. Außerdem aber gab die Anstalt denen, die nicht behaust werden konnten – armen Schiffern, Durchreisenden, Schiffbrüchigen und natürlich auch den Waisen –, Lebensmittel, Feuerung, Kleidung und später Geld. Immer reichlicher flossen die Spenden der Kaufleute und Reeder; […] auch der Brauch, einen Teil des Erlöses aus wohlgelungener Fahrt in die ‚Gotteskiste‘ einzulegen, und alljährliche Sammlungen in der ganzen Stadt […] ermöglichten einen immer weiteren Ausbau des großen Liebeswerkes.“
1618 war Haus Seefahrt in der Lage, den Bau des Vegesacker Hafens zu finanzieren. Weil die Weser immer mehr versandete, brauchten die Bremer Schiffer einen zugänglichen Hafen zum Warenumschlag und als Winterlager.
Brüning Rulves war wohl der erste Bewohner einer Prövenkammer in Haus Seefahrt. Mit drei Frauen feierte er seinen feucht-fröhlichen Einstand: „Anno 1581 den 27. April kam ich in die Seefahrt, schlief dort die erste Nacht auf meiner Kammer. Mit mir kamen Hille Rulves, Kuneke Natelers, Gebbeke Dreyers. Wir tranken eine Kanne Bier.“ Als Prövener genoss Rulves freie Kost und Logis. Dort lebte er bis zu seinem Tod im Jahr 1600. Vermutlich fungierte Rulves auch als Hausverwalter. Bei der jährlichen Abrechnung erhielt er von den Vorstehern des Hauses Seefahrt oder ihren Frauen Hosen und Unterhosen, Pantoffeln und Hemden, einmal auch einen kleinen Kronleuchter und ein „Schapp“ für seine Kammer.
Das war der Anfang. Heute umfasst der Seefahrtshof in Grohn acht Häuser mit 24 Drei- und zwölf Zweizimmerwohnungen in einer Parkanlage von zwei Hektar.