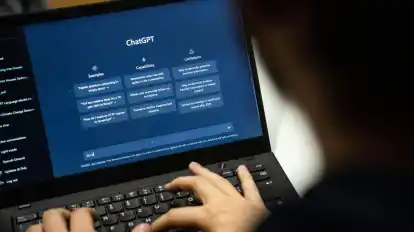Es ist noch nicht lange her, da gehörte das, was in diesen Tagen die Experimentierfreude von Millionen von Internetnutzern anfacht, allenfalls ins Genre der Science-Fiction. Computer, die malen, sprechen, schreiben können, das Ganze rasend schnell von der Aufgabenstellung bis zum Ergebnis. Und jetzt – nicht wenige mögen den Eindruck haben: ganz plötzlich – ist das alles Realität.
Allen voran lässt der Sprachroboter Chat GPT seine Anwender staunen. Ein Computer, mit dem man Textnachrichten austauschen, Dialoge führen kann, der dichtet, Reden und Computercodes schreibt, der auf jede Frage eine Antwort zu haben scheint. Selbst Digital-Experten sprachen nach der Veröffentlichung des sogenannten Chatbots im November 2022 von „Zäsur“ und „Quantensprung“, Christoph Keese vom Nachrichtenportal „The Pioneer“ bemüht gar das Bild vom achten Weltwunder. Doch die Debatte rund um Chat GPT im Speziellen und Künstliche Intelligenz (KI) im Allgemeinen ist nicht nur deswegen so intensiv, weil die Fähigkeiten der neuen schlauen Maschinen positiv beeindrucken. Sondern weil sie in demselben Maße beängstigen.
- Lesen Sie auch: ChatGPT: Wie funktioniert die neue Hightech-Schreibmaschine?
Was bedeutet eine derart intelligente Schreibmaschine für das Bildungssystem? Welche Branchen werden ihretwegen bald Arbeitsplätze abbauen? Oder auch viel fundamentaler: Wissen schlaue Maschinen, was gut ist und was böse? Wie schlau werden sie noch? Die ernüchternde Antwort: Man weiß es nicht. Es ist kaum überschaubar, weil die möglichen Auswirkungen auf die Gesellschaft mindestens so komplex aufzuschlüsseln sind wie der Computercode, der hinter Künstlicher Intelligenz steht. Schon der geniale Physiker Stephen Hawking sagte: „Künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich das Beste oder das Schlimmste, was der Menschheit passieren kann.“
Die Politik behandelt die digitale Welt immer noch als Nebensache
Tatsächlich sind die fehlenden Antworten auf diese Fragen gar nicht das größte Problem, das sich angesichts der Entwicklungen im Hightech-Sektor offenbart, sondern die Tatsache, dass viel zu viele offene Fragen laut werden, immer wenn die digitale Welt sich wandelt.
Eltern, Lehrer, Professoren sind weitgehend allein gelassen, wenn es darum geht, sich mit Chancen und Risiken neuer digitaler Entwicklungen auseinanderzusetzen und sie einzuordnen – für sich und für die, die von ihnen lernen sollen. Die meisten von ihnen, das belegen zahlreiche Studien, geben unumwunden zu, dass sie damit überfordert sind. Weil sie von ihren Eltern, von ihren Lehrern, von ihren Professoren nicht dafür ausgebildet worden sind. Und weil die Politik immer noch so handelt, als wäre das Digitale eine Nebensache und kein prägender Bestandteil des Alltags.
Das Internet war schon mehr als 40 Jahre alt, als es von Angela Merkel 2013 als „Neuland“ bezeichnet wurde. Währenddessen und danach taten sich ihre CSU-Verkehrsminister, die in Deutschland seit Jahren nebenbei fürs Digitale zuständig sind, vor allem durch Untätigkeit und Fehlleistungen auf diesem Gebiet hervor, arbeiteten sich lieber erfolglos an der Pkw-Maut ab, als die mangelhafte digitale Infrastruktur auf Vordermann zu bringen.
Ampel löst Versprechen vom "digitalen Einbruch" bisher nicht ein
Auch die Regierung unter Olaf Scholz konnte sich nicht dazu durchringen, ein eigenes Digital-Ministerium einzurichten. Zwar wurde im Koalitionsvertrag ein „umfassender digitaler Aufbruch“ anvisiert, doch es lässt sich auch nach mehr als einem Ampel-Jahr kein Digitalthema ausmachen, das nennenswert vorangetrieben worden wäre. Womöglich auch, weil das Digitale eben nicht nur am Digitalminister hängt: Bei Datenschutz und Cybersicherheit redet das Innenministerium mit, bei der Abstimmung der europäischen Datenstrategie kommt das Wirtschaftsministerium ins Spiel, an anderen Stellen auch Finanzministerium und Kanzleramt. Keiner gibt eine Linie vor, die Reibungsverluste sind immens.
Und so sind jeden Tag viele Milliarden Menschen miteinander vernetzt, sie arbeiten, streiten, lügen und betrügen online – und es gibt keine nationale oder gar internationale politische Instanz, deren Hauptaufgabe es ist, Regeln dafür zu entwerfen, aufzuklären, uns als Gesellschaft vorzubereiten auf den digitalen Wandel, der sich immer schneller vollzieht, weil Maschinen wie Chat GPT eben immer mehr können und dadurch auch immer schneller schlauer werden. Jedes noch so simpel zusammengeschraubte Auto muss regelmäßig zum TÜV, aber Software, die potenziell die Welt verändert, kann einfach so auf den Markt geworfen werden und wird politisch erst zum Thema, wenn sie die Welt schon ein Stück weit verändert hat.
- Lesen Sie auch: Studie: ChatGPT meistert Fragen eines US-Medizinexamens
Facebook und Youtube sind dafür gute Beispiele. Die sozialen Netzwerke werden bald 20 Jahre alt. Mindestens genauso lange verbreiten sich auf diesen Plattformen täglich und tausendfach Beschimpfungen, Drohungen und Hassnachrichten, die strafrechtlich relevant sind, aber nicht verfolgt werden.
Erst im Februar 2022 trat eine schärfere Form des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) in Kraft, das Betreiber solcher sozialer Netzwerke mit mehr als zwei Millionen Nutzern dazu verpflichten sollte, strafbare Inhalte künftig nicht mehr einfach nur zu löschen, sondern sie auch ans Bundeskriminalamt (BKA) zu melden. Allerdings hielten die Betreiber dies trotz ihrer Milliardengewinne und Algorithmen für unverhältnismäßig, klagten und wurden aus der Pflicht genommen. Also bleibt der Hass sichtbar – für potenziell mehrere Milliarden Menschen weltweit, die die beiden Plattformen in jedem Monat nutzen, für Zigtausende Kinder und Jugendliche, die jeden Tag mehr Zeit auf Plattformen wie diesen verbringen als in der analogen Welt.
Chat GPT könnte das Problem von Fakenews und Hetze bei Facebook und Co. vergrößern
Gerade im Hinblick auf soziale Netzwerke könnten Programme wie Chat GPT diese Probleme noch vergrößern. Sie könnten Diskussionen im Internet beeinflussen, indem sie massenhaft Falschmeldungen verbreiten. Und den Code, der sie automatisiert diskutieren lässt, könnten sie gleich mitprogrammieren. Immerhin: Der Bundestag lässt die möglichen Auswirkungen des Textroboters nun untersuchen. Der zuständige Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hat dazu eine Studie in Auftrag gegeben.
Es steht allerdings zu befürchten, dass Propagandisten und Kriminelle nicht erst auf runde Tische und Studien warten, bevor sie die neue Technik für ihre Zwecke zu missbrauchen versuchen. Auch hier hätte die Politik deutlich früher reagieren können: Chat GPT ist wie andere Programme der neuen KI-Generation nicht vom Himmel gefallen, sondern in früheren Ausbaustufen schon seit Jahren im Einsatz.
Sicher muss man es den größten Pessimisten nicht gleichtun und in der neuen KI-Generation apokalyptische Vorboten sehen, etwa für Szenarien wie in den Filmen der „Matrix“-Reihe, in denen Maschinen so intelligent werden, dass sie den Menschen als Feind erkennen, versklaven und bekriegen können. Doch Vorsicht ist angebracht – allein schon, weil es nur wenige sind, die die Funktionsweisen dieser Maschinen wirklich verstehen, und weil selbst sie nicht annähernd in der Lage sind einzuschätzen, wo und wie Risiken entstehen können. Vielmehr als den schlauen Maschinen sollten unsere Sorgen aber den politischen Entscheidern gelten, die es seit Jahren versäumen, die digitale Welt als prägenden Bestandteil des alltäglichen Lebens anzuerkennen, und so dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft einen mündigen Umgang mit ihr erlernen kann.